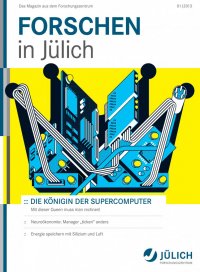
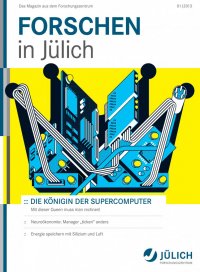
1|2013 Forschen in Jülich 13 Mustern zu entscheiden, wurden bisher rein empirisch – also mit Fragebögen – untersucht“, erklärt Svenja Caspers. Sie wollte es mit ihrem Team genauer wissen und ließ 35 Managerinnen und Manager aus unterschiedlichen Branchen sowie eine passende Vergleichsgruppe aus Ar- beitnehmern ohne Führungsposition Ent- scheidungen fällen. Dabei beobachteten die Forscher per funktioneller Magnetre- sonanztomografie (fMRT), welche Berei- che des Gehirns während der Entschei- dungsfindung besonders aktiv waren. ENTSCHEIDUNGEN IM SEKUNDENTAKT „Die Probanden mussten innerhalb von zwei Sekunden einen Begriff aus ei- nem Wortpaar wie ,Teamwork‘ oder ,Er- folg‘, ,Macht‘ oder ,Loyalität‘ bezie- hungsweise ,Sorgfalt‘ oder ,Kompetenz‘ wählen“, erläutert die Forscherin. Insge- samt galt es, 540 Entscheidungen inner- halb von 22 Minuten zu treffen. Die Pro- banden sollten sich spontan und rasch entscheiden, welches Wort ihnen eher zusagt; richtig oder falsch gab es nicht. Die Auf- gabe scheint leicht, jedoch hat das Gehirn innerhalb weniger Millisekunden eine Menge zu tun: Zei- chen leuchten auf, blitz- schnell entscheidet das Gehirn, ob es sich um Buchstaben handelt und ob sich daraus Worte erge- ben. Welchen Inhalt haben die Worte und welche Bedeutung ha- ben sie für mich? „Die Begriffe Ob schnelle Entscheidungen auch die richtigen sind, lässt die Studie der Jüli- cher Forscherin Dr. Dr. Svenja Caspers offen. müssen dann noch gegeneinander abge- wogen werden und der Proband muss sich entscheiden, welcher Begriff ihn eher anspricht“, beschreibt Svenja Cas- pers die Situation. Ein gut eingespieltes neuronales Netz- werk arbeitet die Aufgabe systematisch ab: In verschiedenen Hirnregionen wer- den visuelle und akustische Informatio- nen verarbeitet, der präfrontale Kortex empfängt und verarbeitet die von dort ankommenden Signale und verknüpft sie mit bereits vorhandenem Wissen. Im so- genannten Nucleus caudatus – auch Schweifkern genannt – werden Hand- lungsmuster aus der Vergangenheit ge- sammelt und bei ähnlichen Begebenhei- ten automatisch abgerufen. Er hilft dabei, Entscheidungen schneller zu treffen. Das kann für Situationen, in denen die gleiche Art von Entscheidungen wiederholt ge- troffen werden muss, hilfreich sein. „Grundsätzlich sind die Pfade bei al- len Menschen sehr ähnlich aufgebaut“, betont Svenja Caspers. „Es ist nicht so, dass diese Netzwerke bei einigen Men- schen gar nicht beschritten werden. Es gibt jedoch eine Verschiebung des Schwerpunkts, an dem im Netzwerk ver- stärkt gearbeitet wird.“ So ergab die aktuelle Studie, dass der Entscheidungs- prozess im Gehirn der Nicht-Manager stufenweise unter Einbeziehung vieler verschiedener Hirnareale ablief. Bei den Managern mit Führungsverantwortung hingegen war verstärkt das Hirnareal des Nucleus caudatus aktiv. Zugleich traf diese Gruppe ihre Entscheidungen auch schneller. Ob sich Manager über Jahre hinweg antrainieren, Entscheidun- gen verstärkt auf dem „schnelleren“ Weg über den Schweifkern zu treffen, bleibt erst einmal eine Hypothese. „Dies ließe sich lediglich im Rahmen einer Langzeit- studie klären“, gibt Svenja Caspers zu bedenken. Sie fügt an: „Ebenso bleibt zu klären, ob sich derartige Unterschiede in der Beanspruchung bestimmter Hirnare- ale auch bei komplexeren Entschei- dungsszenarien zeigen, beispielsweise in Strategiefindungsprozessen.“ :: Brigitte Stahl-Busse FORSCHUNG IM ZENTRUM | Neuroökonomie Institut Originalpublikation